War Napoleon gut für Deutschland?
War Napoleons Herrschaft eher eine Besatzung oder eine Befreiung und inwiefern? Lg Emma
7 Antworten
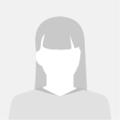
Ja das war schon eine Besatzung und man war froh, als man ihn wieder los war. Aber er führte auch Neuerungen ein, die wir bis heute noch haben und ohne die wir gar nicht mehr leben können (z. B. die Hausnummern). Und er schaffte die Leibeigenschaft ab.


Wie die Deutschen den Alltag unter Napoleon erlebten:
http://www.zeit.de/online/2006/34/zeitgeschichte-franzosen?page=all
Die Franzosen sind da! Schmuggel, Krieg und neue Freiheit - wie die Deutschen den Alltag unter Napoleon erlebten
und
War Napoleon ein Vorbild für Hitler?Fragen, Irrtümer, Kontroversen: Noch immer erhitzt der französische Kaiser die Gemüter. Ein Gespräch mit dem Napoleon-Forscher Jean Tulard.
DIE ZEIT: Die offiziellen Feiern zum 200. Jahrestag der Kaiserkrönung sowie des Sieges von Austerlitz fielen in Frankreich äußerst bescheiden aus. Warum?
Jean Tulard: Bei der Krönung war das verständlich, weil der Staat nicht die Wiedereinführung der Monarchie feiern will. Doch dass der Sieg von Austerlitz 1805, bei dem unsere Grande Armée der Revolution die europäischen Feudalherrscher bezwang, nahezu ignoriert wurde, ist eine Schande. Schuld daran ist unsere Regierung, die dem Druck von Kolonialismus-Kritikern nachgegeben hat.
ZEIT: Worum ging es?
Jean Tulard: Kurz vor dem Jubiläum veröffentlichte der Schriftsteller Claude Ribbe, dessen Vorfahren aus der Karibik stammen, eine scharfe Polemik gegen die Wiedereinführung der Sklaverei durch Napoleon auf Guadeloupe und Santo Domingo. In der Tat hat Napoleon den von der Französischen Revolution verbotenen Menschenhandel 1802 wieder erlaubt. Man sollte das jedoch unter den Bedingungen der damaligen Zeit sehen. Auch in den USA oder Großbritannien war seinerzeit die Sklavenhaltung üblich. Aber weil der Rassismusvorwurf erhoben wurde, und das vor allem von Bürgern aus Guadeloupe, ist unsere Regierung eingeknickt.
ZEIT: Diese Kritiker haben jüngst sogar einen Vergleich zu Hitler gezogen. Auch Napoleon habe - an den Schwarzen - einen Genozid verübt.
Jean Tulard: Das ist völliger Unsinn. Napoleon wollte zwar die Sklaven als Arbeitskräfte ausbeuten, aber er hat keinen Völkermord begangen. Zweifellos war die Repression in der Karibik extrem hart und blutig, nicht zuletzt wegen der Sklavenaufstände. Aber die Behauptung, er habe mit der Unterdrückung der Schwarzen das Vorbild für den Judenmord gegeben, ist völlig absurd. Bei den Nazis ist nirgendwo, auch nicht in Hitlers Mein Kampf oder in Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts, eine Bezugnahme auf Napoleon zu finden. Im Gegenteil: Die Nazis haben viele deutsche Napoleon-Verehrer verfolgt. Es stellt die Fakten in grotesker Weise auf den Kopf, wenn heute Fotos von Hitler vor dem Napoleon-Grab in Paris als Beleg dafür herhalten sollen, der Führer habe damit eine Hommage an sein Vorbild geleistet. In Wirklichkeit war das ein bewusster Akt der Demütigung der feindlichen Franzosen - als Revanche für Napoleons Sieg über die preußische Armee ebenso wie für die Kriegsniederlage 1918. Auch der Hinweis darauf, dass Hitler die Asche von Napoleons Sohn wieder nach Paris zurückbringen ließ, taugt nicht als Beleg. Vielmehr handelte es sich um eine Propagandamaßnahme, mit der die Franzosen kollaborationswillig gemacht werden sollten.
ZEIT: Wie werden die Franzosen denn den 200. Jahrestag der Schlacht von Jena-Auerstedt 1806 begehen?
Jean Tulard: Präsident Jacques Chirac und sein Premier Dominique de Villepin haben die Grundsatzentscheidung getroffen, keinerlei Siege zu feiern. Dahinter steckt viel Druck von der Linken, aber auch die ausgeprägte republikanische Überzeugung des Napoleon-Verächters Chirac. Allerdings war Jena schon kein rein französischer Sieg mehr. Die Armee setzte sich aus vielen ausländischen Kontingenten zusammen. Wir haben Austerlitz ignoriert, aber einen französischen Flugzeugträger zu den Feiern des britischen Sieges bei Trafalgar entsandt - weiter kann man den NapoleonHass nicht treiben. In der Académie française haben wir dagegen heftig, aber leider erfolglos protestiert.
ZEIT: Wann begann der geringschätzige Umgang mit Napoleon?
Jean Tulard: Napoleon war schon immer bei der royalistischen Rechten und bei der extremen Linken verhasst - und bei den ethnischen Minoritäten sowieso. Aber im offiziellen Leben hatte er einen festen Platz - man denke nur an die Marschälle Ferdinand Foche und Joseph Joffre, die bei der Unterzeichnung des Versailler Vertrages 1919 feierlich sein Erbe beschworen. Noch 1969 kam der frisch gewählte Präsident Georges Pompidou ins Institut de France, um Napoleons 200. Geburtstag zu begehen. Damals pries selbst noch die kommunistische Parteizeitung Humanité die Rolle Napoleons als Bollwerk gegen die Reaktion. Die offizielle Geringschätzung begann eigentlich erst mit der Präsidentschaft Chiracs - seit 1995 ignoriert er bewusst sämtliche Jubiläen. Zwar haben viele der napoleonischen Institutionen - Conseil d'état, Légion d'honneur, Code civil, Banque de France, Senat, Nationalarchiv - ihre eigenen Gründungstage gefeiert, das aber eher zurückhaltend.
ZEIT: Sind die Franzosen dieser Entwicklung gefolgt?
Jean Tulard: Nicht wirklich. In der Bevölkerung ist Napoleon unverändert populär. Nicht nur in Frankreich, sondern europaweit war die vierteilige Fernsehserie mit Christian Clavier 2002 ein Riesenerfolg. Napoleon ist und bleibt der berühmteste Franzose aller Zeiten und verkörpert mehr noch als Ludwig XIV. den Höhepunkt der französischen Dominanz in Europa. Dass Politiker heute nicht mehr gern über ihn sprechen, mag auch an den aktuellen Debatten über den déclin français liegen, den Niedergang Frankreichs. Jede Vergegenwärtigung des Kaiserreichs verschärft nur das Bewusstsein der verlorenen Größe.
ZEIT: Warum ist Napoleon auch aus den Lehrplänen verschwunden?
Jean Tulard: Das hat vor allem mit dem Paradigmenwechsel in der Geschichtsschreibung zu tun. Mit Fernand Braudel und der so genannten Annales-Schule rückten die Historiker von der biografischen Methode und von der Faktengeschichte ab. Anstelle der kurzen Perioden betrachteten sie bevorzugt die langen Wellen der Struktur-, Milieu- und Mentalitätsentwicklung. Napoleons nur fünfzehn Jahre währende Epoche fällt einfach durch das Raster einer globaleren Perspektive, die sich beispielsweise lieber auf die Gesamtgeschichte des Mittelmeerraumes im 16. Jahrhundert richtet. Und die republikanische Ideologie - Napoleon als Dynast und als Totengräber der Revolution - tat ihr Übriges.
ZEIT: Napoleon ist aber nicht der letzte französische Monarch gewesen.
Jean Tulard: Den anderen geht es heute nicht viel besser. Da ist zum einen Bonapartes Neffe Napoleon III., der mit seinem Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 die Zweite Republik zerstörte. Seine schwarze Legende fällt auch auf Napoleon I. zurück und verfälscht so die historische Perspektive auf das Erste Kaiserreich. Man hat es Napoleon III. bis heute nicht verziehen, dass er auf seine eigenen Bürger schießen ließ - genausowenig wie Karl X., der beim Juliaufstand 1830 dasselbe tat. Sie sind die verbotenen Souveräne Frankreichs.
ZEIT: Gibt es auch Errungenschaften Napoleons, die heute noch als unumstritten gelten?
Jean Tulard: Er hat sämtliche Grundlagen des modernen Staates geschaffen. Die von ihm errichteten administrativen Strukturen funktionieren in unserem Land bis heute. Viele Institutionen - den Rechnungshof, die Finanzinspektion oder Präfekten - gab es freilich schon im Ancien Régime. Sie wurden von Napoleon lediglich auf das bürgerliche Frankreich zugeschnitten. Im Grunde war ja die Französische Revolution ein Triumph der Bourgeoisie. Arbeiter und Bauern waren dem Aufstand gefolgt, aber geführt und gewonnen haben ihn die Bürger und Notablen, die in den Genuss der von der Revolution konfiszierten Güter kamen. Auch daher rührt die Langlebigkeit unserer Institutionen.
ZEIT: Ziehen Sie für Frankreichs Nachbarn eine ähnlich positive Bilanz des napoleonischen Wirkens?
Jean Tulard: Napoleon hat die Einheit Italiens vorbereitet, den Feudalismus in Deutschland zerstört, den Schweden einen Souverän gegeben. Selbst Marx rühmte den Code civil als Bruch mit der alten Ordnung. Und auch in Russland zählt Napoleon zum Nationalerbe - weil das Zarenreich ihn besiegt hat. Ich bin oft in Moskau und staune immer wieder darüber, wie voll die Auditorien bei meinen Napoleon-Vorträgen sind - obwohl ich nur Französisch spreche. Napoleon hat in ganz Europa die alte Wirtschaftsstruktur liberalisiert und die Kleinstaaterei überwunden. Damit schuf er die Grundlagen für den Wirtschaftsraum zwischen Niederrhein und Italien und nahm das Europa von Gasperi, Schumann und Adenauer vorweg.
ZEIT: Aber nicht nur die Deutschen haben gegen die Fremdherrschaft ihre Befreiungskriege geführt.
Jean Tulard: Napoleon hat die eroberten Völker zu sehr gedemütigt - man denke nur an seinen Bruder Jérôme, den er als König von Westfalen einsetzte, oder an die Erniedrigung der deutschen Souveräne in Dresden vor dem Russland-Feldzug. Damit hat er extreme Gegenreaktionen in Form von Nationalstolz und Freiheitssehnsucht provoziert. Aber ohne ihn hätte es die deutschen Revolutionen von 1830 und 1848 nicht gegeben. Es war das Kennzeichen der fortschrittlichen Kräfte in allen Ländern, dass sie stets "Vive Napoléon!" riefen. Das zwei Jahre nach seinem Tod erschienene Erinnerungsbuch "Mémorial de Ste. Hélène" des Comte de Las Cases von 1823, in dem sich Napoleon als Vollender der Revolution und Befreier der Völker rühmt, war im Europa des 19. Jahrhunderts das meistgelesene Werk. Die damnatio memoriae ist erst jüngeren Datums.
ZEIT: Was waren die größten Fehler des Empereur?
Jean Tulard: Bis zum Frieden von Tilsit 1807 befand sich Napoleon noch im Einklag mit der Nation. Danach begann sein hemmungsloser Egoismus. Mit der Schaffung eines neuen Adels verärgerte er Aristokratie und Bürgertum, seine ruinöse Wirtschaftspolitik vernichtete den selbst geschaffenen Aufschwung, seine Gewaltmaßnahmen führten zum Polizeistaat. Außenpolitisch setzte zur gleichen Zeit mit dem Spanien-Feldzug 1808 sein Niedergang ein. Es war der erste Krieg, der gänzlich ungerechtfertigt war, weil Frankreich ihn begonnen hatte, ohne gegen eine Koalition antreten zu müssen. Spätestens mit dem verheerenden Russland-Feldzug verlor er jegliche Unterstützung.
ZEIT: Warum ist der Mythos Napoleon bis heute trotzdem ungebrochen?
Jean Tulard: Weil seine Auswirkungen universell waren und selbst die verlorenen Kriege Konsequenzen für den gesamten Planeten hatten. Während des Feldzuges gegen Spanien und Portugal konnten sich die lateinamerikanischen Kolonien emanzipieren, von Ägypten bis zum Kap trat Afrika auf die politische Landkarte, Australiens Südküste hieß lange Zeit Côte Bonaparte. Selbst das heutige Straßensystem in Indonesien ist napoleonischen Ursprungs. 1812 zogen die USA an Napoleons Seite erstmals in einen europäischen Krieg. Und immer wieder staune ich darüber, wie groß in Asien das Interesse für Napoleon ist. In Japan, es ist kaum zu glauben, wird er öfter zitiert als General MacArthur.
ZEIT: Sie sind auch Filmhistoriker. Welche Napoleon-Filme gefallen Ihnen am besten?
Jean Tulard: Mit Abstand der Stummfilm von Abel Gance aus dem Jahr 1927. Danach kommt für mich Sergej Bondartchouks Waterloo von 1970, aber auch Ridley Scotts The Duellists von 1977. Und selbst Propagandafilme, die den Napoleon-Mythos für das Kino ausschlachten, sind für mich bedeutende Geschichtsdokumente: Da ist zum einen Koutousov, ein im Auftrag Stalins gedrehter Film, in dem der Sieg von Borodino 1812 mit Stalingrad gleichgesetzt wird. Als Reaktion darauf ließen die Nazis dann Kolberg von Veit Harlan drehen, um aus dem letzten preußischen Widerstand gegen die napoleonischen Truppen einen Durchhalteappell gegen die Rote Armee zu machen. Beide Male ist Napoleon das Medium, an dem Deutsche und Russen sich abarbeiten.
ZEIT: Wie würden Sie Napoleon heute charakterisieren: als Befreier, Staatsmann, Eroberer oder Tyrann?
Jean Tulard:Alles zugleich.
ZEIT: Sie haben Ihrer Napoleon-Biografie von 1978 den Untertitel "Der Mythos des Retters" gegeben. Ist die Vorstellung vom "homme providentiel", vom Mann der Vorsehung, in Frankreich noch aktuell?
Jean Tulard: Unsere Geschichte zeigt, dass das Land in jeder Krise nach einem Retter ruft: Das fängt mit Jeanne d'Arc an, geht mit dem Aufstieg Napoleons nach dem Tod von Robespierre weiter, zeigt sich bei Thiers in der Zweiten Republik und bei Boulanger in der Dritten Republik, bei Marschall Pétain nach der Niederlage 1940 bis hin zu de Gaulle im Algerien-Krieg 1958. Wir haben immer "Retter im Wartestand" - von Georges Pompidou bis zum heutigen Innenminister Nicolas Sarkozy. Doch es ist ebenfalls charakteristisch für die Franzosen, dass der "Mann der Vorsehung" jedes Mal prompt verjagt wird, wenn er seine Schuldigkeit getan hat.
Jean Tulard hat mehr als vierzig Werke zur französischen Geschichte verfasst, die Hälfte davon über Napoleon und seine Zeit. Der 1933 in Paris geborene Autor lehrte an der Ecole Pratique des Hautes Etudes, an der Sorbonne und am Institut d'Etudes Politiques in Paris. Er war Präsident des Institut Napoléon, gehörte dem Vorstand der Cinématheque française an und ist Mitglied der Académie française - Die Zeit am 17.8.06

Bei den meisten wesentlichen Punkten des Code civil bestand Einigkeit zwischen Napoleon und den Juristen. Dazu zählten:
- das Ende der feudalen Rechte,
- Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz,
- die Zivilehe,
- die Unverletzbarkeit des Eigentums,
- die freie Wahl der Arbeit,
- die Freiheit des Gewissens.

Seine Spuren hinterliess er auch im Suedwesten Deutschlands:
https://www.ardaudiothek.de/wissen/napoleons-erbe-bonapartes-spuren-in-suedwestdeutschland/88864798

Am Anfang Besatzer. Er hat es übertrieben mit der Ausbeutung und dann haben sich die deutschen Staaten verbündet. Von daher war er wie ein Katalysator für die Einigung der deutschen.